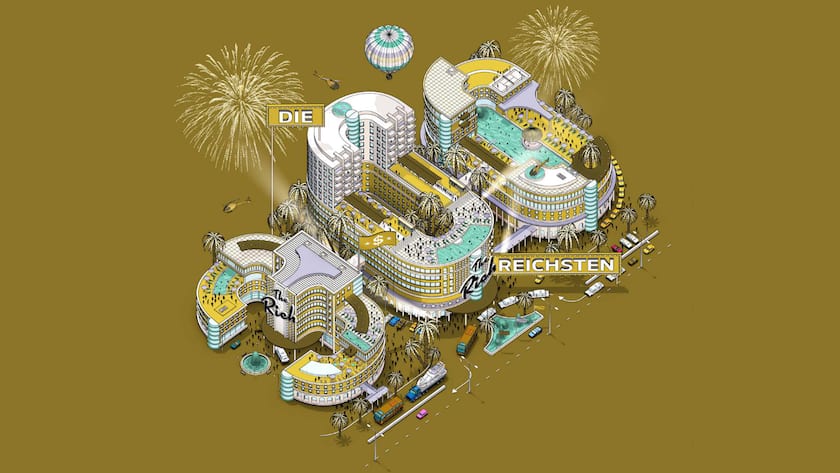Gemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.
Partner-Inhalte