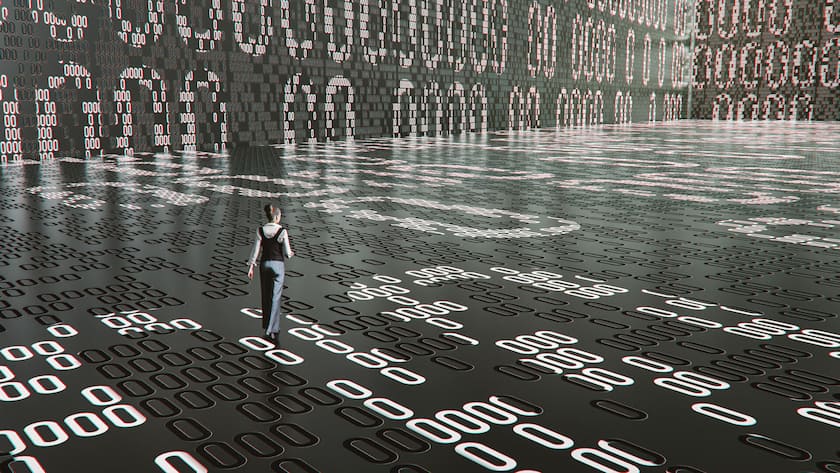Large Language Models (LLMs) haben seit dem Start von Chat GPT durch den Hersteller Open AI die Diskussion um die generative künstliche Intelligenz (Gen AI) geprägt. Inzwischen gibt es einen regen Wettbewerb um die besten und schnellsten Modelle: Dragon LLM, ein Start-up aus Frankreich, hat laut eigenen Angaben gerade ein neues Modell präsentiert, das mit wesentlich weniger Parametern auskommen soll als die Modelle der grossen Hersteller. Und auch das neuste LLM von Open AI, GPT 5, weist gemäss dem Vergleichsdienst Artificial Analysis nur noch einen kleinen Vorsprung gegenüber den Modellen K2 Thinking und M2 auf. Die Hersteller der beiden Modelle? Es sind die hierzulande einigermassen unbekannten chinesischen Start-ups Kimi und Minimax. Die Suche nach dem «besten» globalen LLM ist also in vollem Gange. Doch abseits dieses Wettlaufs der Giganten verschieben sich die Prioritäten schnell, wenn es um die praktische Anwendung in der Wirtschaft geht. Das gilt vor allem für KMU.
Wozu braucht man noch Websites?
Für KMU stehen nicht die schnellsten Modelle im Vordergrund, sondern deren rasche Verfügbarkeit und einfache Implementierung. Wolfgang Schäfer, Dozent für immersives Marketing an der Fachhochschule Graubünden (FHGR), sieht hierfür insbesondere drei Entwicklungen: Einerseits problemzentrierte KI-Agentensysteme, die einzeln oder in Teams vordefinierte, routinemässige Aufgaben erledigen, welche bisher oft von Skripts abgedeckt wurden. Anderseits werden lokale KI-Lösungen zunehmend besser, sind immer leichter einzurichten und zu managen – und zudem günstiger in den Anschaffungs- und Betriebskosten. Während ein Computersystem, das ein mit Chat GPT 4 vergleichbares KI-Modell lokal betreiben konnte, vor kurzem noch über 300'000 Franken kostete, kommt man heute laut Schäfer mit 20'000 Franken sehr gut hin. Dies mache die Technologie auch für KMU bezahlbar. Schäfer hebt die weiteren Vorteile lokaler Lösungen hervor: die erhöhte Datensicherheit, da Kundendaten im Unternehmen bleiben und man nicht auf den Schutz einer Cloud im Ausland vertrauen muss, sowie die bessere Kostenkontrolle, beispielsweise hinsichtlich des Energieverbrauchs.
Und drittens sieht Schäfer das KI- getriebene Marketing: Mithilfe von KI-Lösungen, ob in der Cloud oder zunehmend auch lokal, könnten Unternehmen ihre Produkte, Dienstleistungen und Marken neu vermarkten. Generative Engine Optimization (GEO) beerbe das bekannte SEO (Search Engine Optimization). Er erklärt, dass Händler ihre auf Shopify basierenden Onlineshops bereits seit Anfang April 2025 in Chat GPT integrieren könnten: «Da Kundinnen und Kunden sich immer häufiger für Produktempfehlungen an KI-Systeme wie Chat GPT wenden, bekommen sie nicht nur die Empfehlung genannt, sondern können diese auch gleich im Dialog mit dem Chatbot kaufen, ohne dabei noch die Website eines Onlineshops besuchen zu müssen», beschreibt Schäfer diese Vorgehensweise. Und abschliessend führt er ins Feld: «Spannend ist hier, wofür wir dann in Zukunft überhaupt noch Websites und auch Social-Media-Kanäle benötigen.»
Mitarbeiterwissen nutzen
«Wie bei den meisten Hypes – ob Web3, VR oder jetzt AI – ist die Kunst, das für das Unternehmen wichtige Signal vom Rauschen trennen zu können», erklärt Nico Wyss, Head of Blackbelt AI für Mittel- und Osteuropa bei SAP in der Schweiz. Die wichtigste Unterscheidung ist in seinen Augen jene zwischen konkretem Geschäftsnutzen und Technologie-Hype. «Meine Empfehlung: Orientieren Sie sich an Use-Cases, nicht an Buzzwords oder Technologien», rät der Experte. «Fragen Sie sich: Welche wiederkehrenden Aufgaben kosten uns Zeit? Wo brauchen wir bessere Entscheidungsgrundlagen? Wo verlieren wir Wissen?» Und dann kann man prüfen, welche KI-Technologie diese spezifischen Probleme löst.
Zudem sollte man auf messbare Outcomes achten, hält Wyss fest: «Reduziert KI nachweislich Kosten? Spart es dokumentierte Arbeitszeit? Erhöht es die Kundenzufriedenheit? Ziel sollte sein, massgeblich Top- oder Bottom-Line zu beeinflussen. Alles andere ist Consulting-Theater. Seien Sie skeptisch bei Anbietern, welche Ihnen erzählen, Sie bräuchten eine ‹KI-Transformation›. Sie brauchen Lösungen für konkrete Probleme.» Für KMU hat Nico Wyss eine klare Empfehlung: «Beginnen Sie intern mit Pilotprojekten – aber mit der richtigen Messdisziplin.» Viele Lösungen seien low-code oder sogar no-code nutzbar, etwa durch Plattformen wie Joule Studio oder N8N, oder sie sind frei verfügbar in Frameworks wie Langchain oder Pydantic AI. «Der entscheidende Punkt: Agentic AI braucht Kontext. Und genau hier liegt die Stärke integrierter Plattformen und von KI, die bereits native in Ihre Businessprozesse mitgeliefert wird», so Wyss weiter. «Ein isolierter KI-Assistent kennt die individuellen Geschäftsprozesse nicht.» Ein gut integrierter Business-Assistent hingegen weiss um die Bestellhistorie, die Lieferanten und die Finanzstrukturen. «Das ist der Unterschied zwischen einem cleveren Chatbot und einem echten Business-Assistenten.» Am wertvollsten ist es laut Wyss, interne Champions – Mitarbeitende – zu identifizieren, die experimentieren wollen. Dazu sagt er abschliessend: «Geben Sie ihnen Budget und Freiraum. Die besten KI-Anwendungen entstehen oft dort, wo Mitarbeitende ihre eigenen Schmerzpunkte lösen.»