Die meisten Start-ups scheitern. Aber kein Start-up scheiterte in der Schweiz so öffentlich wie Ava. Der Aufstieg und der spätere Sturz des Unternehmens waren derart spektakulär, dass der Fall Fragen aufwirft. Was haben wir aus dieser Geschichte gelernt? Was hat sich seit dem Ava-Hype in der Schweizer Start-up-Welt verändert? Welche Lehren gilt es für Investorinnen, Start-up-Gründer und auch für Journalisten und Journalistinnen zu ziehen?
Lehre Nummer eins: Investoren sind heute definitiv kritischer. Es scheint nicht mehr denkbar, dass es in der Schweiz erneut ein Jungunternehmen mit neunzig Investorinnen und Investoren an Bord gibt, die sich über die Strategie der Firma uneins sind und den Gründern mit Klagen drohen.
Jeder Hype ist eine Hypothek
Investoren dürften inzwischen auch engagierter sein. Dass die ehemalige VR-Präsidentin von Ava im Gespräch sagt, «Niemand war da, der wirklich Verantwortung übernehmen wollte», ist ein Armutszeugnis. Von Geldgebern muss erwartet werden, dass sie sich selbstkritisch fragen, ob sie wirklich «smart money» sind oder «dumb money» – also dem Start-up zwar Cash liefern, aber keine Netzwerke, keine Expertise und keine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mitbringen.
Der Autor
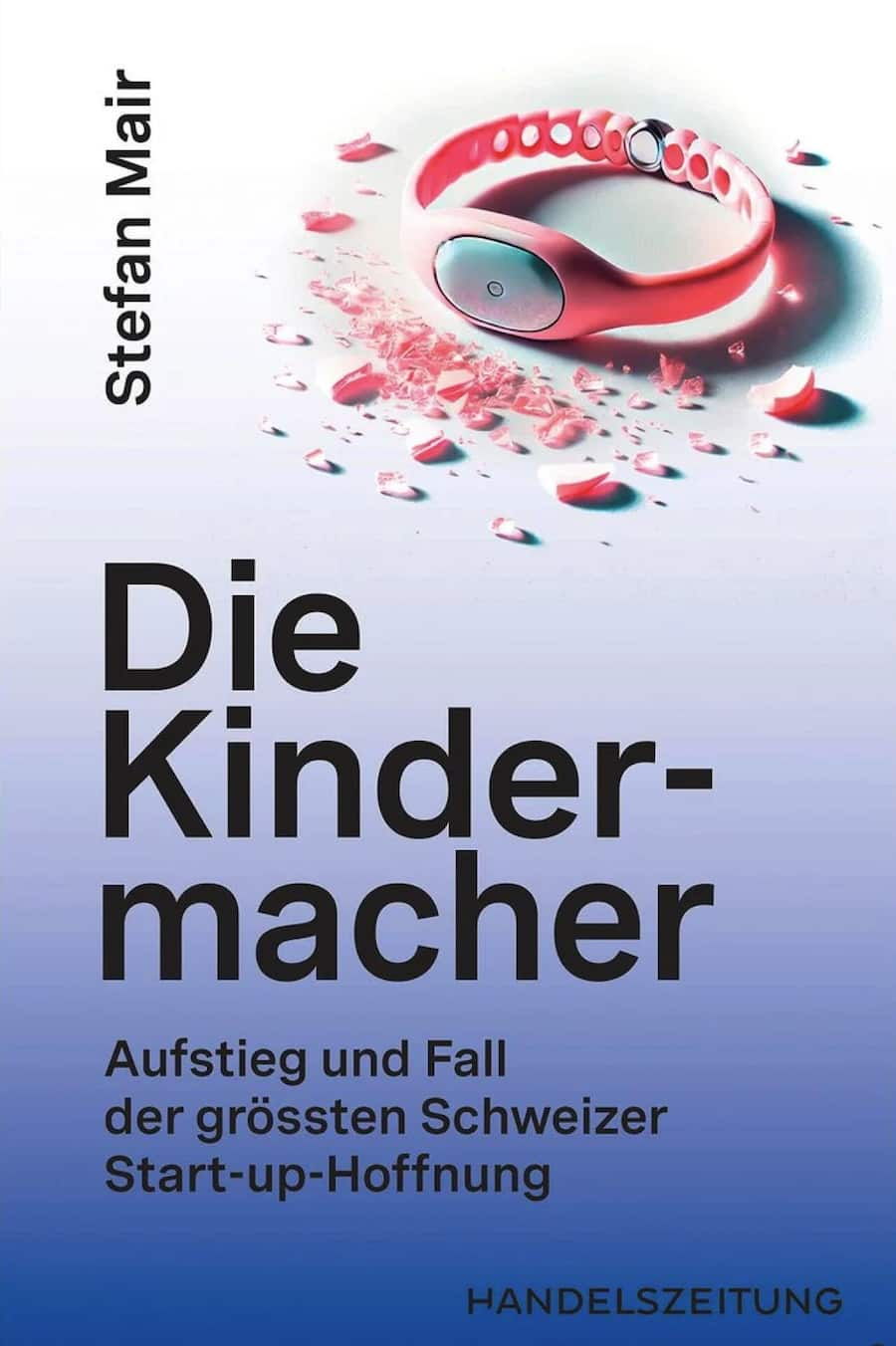
Stefan Mair ist Journalist und Autor des Buches «Die Kindermacher».
Der Fall Ava sollte jedoch auch uns Journalistinnen und Journalisten eine Lehre sein. Viele Fragen – etwa nach der Qualität der Produkte – hätten früher gestellt werden müssen. Stattdessen muss in der Rückschau konstatiert werden, dass die Marketingversprechen allzu schnell Eingang in die Berichterstattung gefunden haben. Wer über Start-ups berichtet, sollte sich zudem bewusst sein, dass der Hype, den auch Medien erzeugen, für Gründerinnen und Gründer eine Hypothek sein kann, die es schwierig macht, selbstkritisch zu agieren und Fehler zu korrigieren.
Umgang mit Scheitern normalisieren
Gleichzeitig muss die Lehre aus dem Fall Ava sein, dass unternehmerisches Scheitern keine Ausrede für Häme sein darf. Ava wurde hoch- und wieder niedergeschrieben. Auf beides hätte die Firma sicher verzichten können. Medien müssen ein Scheitern in der Start-up-Welt beschreiben und die Gründe dafür analysieren. Nüchternheit statt Häme ist hier aber das Gebot.
Drittens hält der Fall Ava auch für Gründerinnen und Gründer Lektionen parat: So ist die Überidentifikation mit der Firma, wie sie Ava-Gründerin Lea von Bidder gespürt hat, eher kontraproduktiv. Zwar wird von Start-up-Coaches immer wieder gefordert, alles für das Projekt zu geben.
Doch der mentale Preis dieser Überidentifikation wird vor allem im Fall des Scheiterns enorm. Und er verhindert, dass Gescheiterte wieder neue Gründungen wagen. Letzteres ist aber die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Ökosystem. Es kann nicht sein, dass Gründer drei Jahre abtauchen müssen und erst dann wieder Energie für eine neue Gründung haben.



