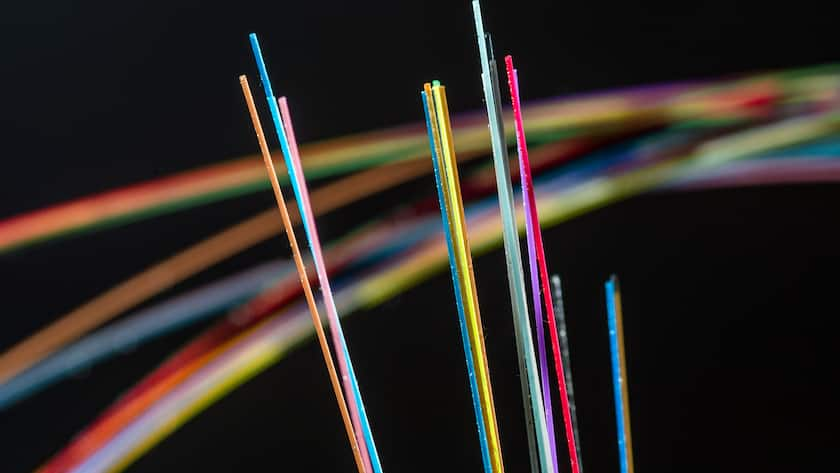Fredy Künzler ist sauer. An der Zürcher Uetlibergstrasse will er mit seinem Provider Init7 ein neues Studentenwohnheim mit schnellem Internet versorgen. Die Hausverkabelung ist erledigt, die Hardware des Providers ist installiert. Doch der Anschluss an das städtische FTTH-Glasfasernetz fehlt noch immer, weil das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) sich weigert, die entsprechende Dose zu montieren. «Ich bin der Meinung, dass das EWZ gegen geltendes Recht verstösst», sagt Künzler. Er sieht sich mit Machtspielen marktmächtiger Unternehmen konfrontiert.
Bestellt hat Init7 den Anschluss bei der halbstaatlichen Swisscom, die zusammen mit dem EWZ das Netz in Zürich baut und betreibt. Swisscom habe darauf dem EWZ den Auftrag geben, den Anschluss zu erstellen, denn das Studentenheim befindet sich in einem Quartier, in dem das EWZ alle Anschlüsse baut. Doch dann verweigerte das EWZ die Montage der wichtigen Glasfaserdose im Haus. Sowohl Künzler, als auch EZW-Sprecher Harry Graf bestätigen diese Darstellung. Die Swisscom will sich dazu nicht äussern. Was war passiert?

Fredy Künzler: Der Init7-Chef nimmt es in Zürich mit dem Branchenschwergewicht EWZ auf.
Weiterverkauf statt Gemeinschaftsnutzung?
Das EWZ sieht in Künzlers Gemeinschaftsanlage eine Verletzung der Vertragsbedingungen. «Das ist kein Verbraucheranschluss, sondern ein Anschluss für eine kommerzielle Nutzung mit dem Zweck des Weiterverkaufs», sagt EZW-Sprecher Graf. Das entspreche nicht dem Sinn des städtischen Glasfasernetzes. Stattdessen bietet das EWZ dem Provider eine Glasfaserverbindung für Profis an. Zu anderen Konditionen.
Das hätte für das EWZ zwei Vorteile. Erstens gehört eine solche Leitung dann nur dem EWZ, während die Glasfaserstränge im städtischen Netz sowohl vom EWZ, als auch von Partnerin Swisscom – in Konkurrenz zu einander – genutzt werden können. Viel wichtiger aber: Der Profi-Anschluss wäre teuer. Viel teurer.
«Das was wir wollen, ist nichts, was es nicht schon gibt. Ob Studentenheim oder Hotel – ich habe in beiden Fällen Bewohner, die eine gemeinsame Internet-Infrastruktur nutzen.»
Fredy Kuenzler, Geschäftsführer Init7
Für einen normalen Glasfaseranschluss bezahlt der Provider Init7 beim EWZ heute 26.50 Franken pro Monat. Bei Swisscom kostet eine solche Leitung 29 Franken. Der von EWZ offerierte Grosskundenanschluss hingegen kostet 600 Franken pro Monat. Dreissig Mal so viel. Technisch unterscheiden sich die Produkte kaum. In allen Fällen mietet Internet Provider Init7 eine so genannte «nackte» Glasfaser. An beiden Enden des Kabels muss der Provider eigene Hardware installieren, um Daten übertragen zu können.
Nichts, was es nicht schon gibt
«Das was wir wollen, ist nichts, was es nicht schon gibt», sagt Künzler. Bereits heute versorge er Hotels, Altersheime und Studentenheime in Zürich nach dem genau gleichen Modell. «Ob Studentenheim oder Hotel – ich habe in beiden Fällen Bewohner, die eine gemeinsame Internet-Infrastruktur nutzen». Er unterstellt dem EZW willkürliches Handeln. Und eine Retourkutsche.
Dem Fall voran gegangen sind andere Streitereien. Denn Künzler hat das EWZ und Swisscom beim Preisüberwacher wegen ihrer Preispolitik auf dem Glasfasernetz angezeigt. Bereits wurden Swisscom und EWZ offenbar zu Stellungnahmen eingeladen.

Fredy Künzler: Der Chef von Init7 steht im Clinch mit der EWZ.
Künzler sagt, die Glasfaser-Netzbetreiber benachteiligten Anbieter wie Init7, die ihre Dienstleistungen auf nackten Fasern anbieten wollen. Man spricht auch von «Layer-1-Angeboten», wenn Provider bis auf das Kabel keine weiteren Vorleistungen beziehen (siehe Infobox unten).
«Die Netzbetreiber hingegen fördern so genannte Layer-2-Angebote mit zu tiefen Preisen, und stellen uns damit schlechter», sagt Künzler. Damit gemeint ist: Für Provider kann es billiger sein, ohne eigene Hardware lediglich Datenverkehr bei Swisscom und EWZ einzukaufen. «Das macht keinen Sinn.» Künzler unterstellt Swisscom und EWZ, Anbieter auf Layer 1 bewusst schlechter zu stellen, um diesen Geschäftsmodellen das Wasser abzugraben. «Sie wollen die Wertschöpfung selber erbringen und den Markt kontrollieren.»
Bei Datennetzen spricht man von verschiedenen Schichten oder Layers, wenn es darum geht, wie die Netze von Kunden und Serviceanbietern genutzt werden. Das so genannte OSI-Modell baut auf 7 Schichten auf. Die niedrigste Schicht ist die reine Hardware-Schicht. Je höher die Zahl, desto hardware-ferner wird die Nutzung.
Layer 1 beschreibt die physikalische Infrastruktur: Kabel, Glasfaserstränge, Anschlussdosen. Bei Glasfasernetzen spricht man auch von «nackten» oder «unbeleuchteten Fasern». Anbieter wie Init7 oder Salt nutzen Layer-1-Angebote, um fremde Glasfasern für den Anschluss an ihre Telekom-Netze zu nutzen. Dabei mieten sie eine Faser, ohne weitere Infrastruktur der Netzbetreiber in Anspruch zunehmen.
Layer 2 beschreibt die Daten-Ebene. Im Falle von Glasfasernetzen spricht man von «beleuchteten Fasern». An den Enden der Kabelbefinden sich bereits Geräte, die den Datentransport auf den Glasfasern steuern. Ein Internet-Provider kann eine Layer-2-Verbindung nutzen, um Daten zu transportieren, ohne eigene Wandler am Ende der Glasfasern installieren zu müssen.
Layer 3 und 4 beschreiben Internet-Dienste, also die Übertragung von Daten nach Internet-Standards. Nutzer solcher Dienste benötigen gar keine eigene Hardware mehr. Sie mieten sich lediglich Bandbreiter bei einem Netzbetreiber wie der Swisscom.
Layer 5 bis 7 beschreiben konkrete Anwendungen, etwa Internet-TV oder Telefonieanwendungen, die auf bereits bestehenden Datenverbindungen aufbauen. Anbieter wie Zattoo haben mit der genutzten Hardware gar nichts mehr zu tun.
Die öffentlich einsehbaren Tarife bestätigen: Layer-2-Anschlüsse mit wenig Geschwindigkeit sind günstiger als das Mieten eines nackten Kabels auf Layer 1 – und das, obwohl Layer-2-Angebote in der Herstellung teurer sind. Unabhängig von der angebotenen Bandbreite, die auf die Produktionskosten praktisch keinen Einfluss hat.
Für Künzler sind das alles Belege dafür, dass der Markt bei den Breitband-Verbindungen nicht spielt und die grossen Netzbesitzer ihre Marktmacht ausnützen. «Daher braucht es eine Zugangsregulierung.» Diese jedoch hat die nationalrätliche Fernmeldekommission gerade bachab geschickt.
Das Revision des Fernmeldegesetzes, die diese Woche im Parlament behandelt wird, sah eigentlich eine Zugangsregulierung vor. Der Bundesrat schlug vor, dass eine Behörde die Nutzung von Leitungen regulieren könnte, wenn der Markt nicht spielt. So wie das früher bei den alten Kupferleitungen der Swisscom der Fall war. Seit langem lobbyieren die Telekom-Unternehmen in dieser Sache.
Doch die parlamentarische Kommission strich dieses Paragrafen wieder heraus. Zum Ärger der meisten Telekom-Unternehmen, die sich in der «Allianz der Fernmeldedienstanbieter» zusammengeschlossen haben. Dieser gehören unter anderem auch Salt, Sunrise und UPC an.
Ob die Regulierung direkt in seiner Situation angewandt werden könnte, kann Künzler nicht einschätzen. «Aber sie hätte auf jeden Fall einen indirekten Einfluss», ist er sich sicher. «Alleine die Androhung einer Zugangsregulierung wirkt mässigend auf marktmächtige Unternehmen wie die Swisscom.»
Umstrittene Regulierung im FMG
Künzler denkt dabei vor allem an ländliche Gegenden, wo die Swisscom oft als einzige schnelle Datenverbindungen anbietet. Dort, wo es keine Kabelnetze wie UPC oder städtischen Glasfasernetze gibt, die als Konkurrenten auftreten. «Konsumenten auf dem Land bezahlen heute deutlich mehr für schnelles Internet als jene in Städtischen Gebieten», sagt Künzler. Er verweist auf einen Bericht von SRF, nachdem die höheren Preise pro Jahr 600 Millionen Franken ausmachten.
«Eine Regulierung des Netzzugangs würde den Anreiz senken, selbst zu investieren.»
Armin Schädeli, Sprecher Swisscom
Bekämpft wird die Zugangsregulierung in erster Linie von der Swisscom. Die neuen Netze seien im Wettbewerb entstanden und es gebe keinen Grund, diese Netze jetzt zu regulieren, sagt Firmensprecher Armin Schädeli. Der Wettbewerb spielte sowohl auf Wholesale- wie auch Retailebene. «Eine Regulierung des Netzzugangs würde den Anreiz senken, selbst zu investieren.»
Für Init7-Chef Künzler spielt das alles keine Rolle. Er kann nicht auf das neue Gesetz warten, um seine Studentenüberbauung zu verkabeln. Er ist mit der Sache an den Zürcher Stadtrat gelangt, und hofft auf einen Kompromiss. Zumindest einen provisorischen Anschluss. «Die Stadt spricht immer von Förderung der Studenten, und hier stellt sie sich quer. Das kann doch nicht sein.»