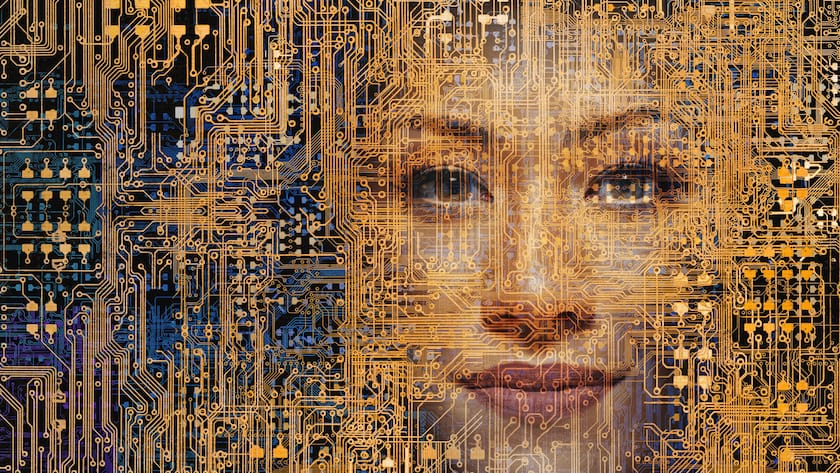Künstliche Intelligenz (KI) hat den Status als futuristisches Gimmick längst abgelegt und ist im Kern des Schweizer Mittelstands angekommen. Der Siegeszug der KI zwingt vor allem die KMU zur Entscheidung, sich anzupassen oder abgehängt zu werden. Dabei wird die Technologie – anders als viele angenommen haben – nicht nur Routineaufgaben optimieren, sondern das Gefüge der KMU-Arbeitswelt radikal neu gestalten. Doch trotz dem enormen Potenzial herrscht bei Schweizer KMU eine merkwürdige Mischung aus Faszination und Angst vor. Diese Skepsis ist ein gefährlicher Bremsklotz für die notwendige digitale Transformation, die ein Schlüsselfaktor zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit ist. Viele KMU sehen in der KI eine unerreichbare Technologie, die nur von Konzernen mit endlosen IT-Budgets gestemmt werden kann. «Dabei wird übersehen, dass moderne, modulare Cloud-Lösungen den Zugang deutlich vereinfachen und die Implementierungszeiten verkürzt haben», sagt Alexander Finger, CTO bei SAP Schweiz. Parallel dazu bietet die Modularität von Cloud-Lösungen die grosse Chance, nur die Funktionen zu nutzen, die wirklich gebraucht werden, und ermöglicht so eine Skalierbarkeit in Menge und Komplexität. Eine entscheidende Komponente in einem volatilen Markt.
Keine Evolution, sondern Revolution
KI schadet den KMU nicht, sie revolutioniert sie. Und diese Revolution trifft Mitarbeitende und Geschäftsmodelle gleichermassen. In einem Hochlohnland wie der Schweiz ist die Steigerung der Produktivität durch KI von existenzieller Bedeutung. «Der Mehrwert der Technologie erschliesst sich nur dann, wenn sie akzeptiert und durch die Menschen im Unternehmen genutzt wird. Die Voraussetzung dafür ist eine sichere und praxisnahe Integration», so Finger. Die primären Vorteile der KI für Schweizer KMU liegen in der Optimierung von Prozessen und in der Automatisierung von Routineaufgaben. Die Automatisierung geht dabei über einfache Wenn-dann-Regeln hinaus. Intelligente Agenten sind in der Lage, komplexe Probleme selbstständig zu lösen. «Wir sprechen von KI-Assistenten, die mehrstufige Aufgaben auch dann zuverlässig und den Menschen unterstützend abwickeln, wenn etwas nicht wie geplant abläuft», sagt Finger, und er ergänzt: «KI ermöglicht es KMU, völlig neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die früher aufgrund der notwendigen Datenverarbeitung unmöglich gewesen wären.»
Dies erfordert jedoch, dass die Firmen einen Innovationsprozess etablieren, um neue externe und interne Veränderungen zu bewerten und zu integrieren. Und zwar am besten jetzt und nicht erst morgen. «Wer KI erfolgreich integrieren und ihr Potenzial ausschöpfen will, handelt jetzt «, sagt Finger. «Der optimale Ansatz zur Einführung folgt dabei strategischen Schritten.» Unternehmen, die noch am Anfang stehen, rät er zu Discovery-Workshops, um ihre spezifischen Prozesse und ihren Reifegrad zu analysieren. Darauf aufbauend ist es ratsam, auf den Fit-to-Standard- Ansatz zu setzen, anstatt auf langwierige Gap-Analysen. «Führe die Mitarbeitenden so schnell wie möglich an das neue, KI-fähige Standardsystem heran, und arbeite mit dem Delta zwischen Ist und Standard», meint Finger. «Die Mitarbeitenden kommen so schnell in das neue System und erleben, wie es funktioniert.» Dabei gilt es, klare Regeln für den Umgang mit KI zu schaffen. Zudem funktioniert ein Projekt dort am besten, wo Vertrauen herrscht und man weiss, dass man Fehler machen darf. «Fehler gehören zum Lernprozess dazu», sagt Finger, «dies fördert die Akzeptanz und hilft, Widerstände zu überwinden.» Da die technologische Entwicklung digitales Fachwissen schnell obsolet macht, werden zwei übertragbare Kompetenzen in Zukunft essenziell, um KI als «Partner zu führen».
Die erste ist kritisches Denken und Datenkompetenz (Digital Ethics). Mit diesen Fähigkeiten können Mitarbeitende besser KI-Outputs kritisch hinterfragen und Datenqualität beurteilen. Dies beinhaltet auch das Verständnis der ethischen Implikationen der KI-Entscheidungen. Die zweite Kompetenz ist die Dialog- und Konfliktfähigkeit (transformative Kompetenz). Die KI-Transformation erfordert die Kommunikation zwischen technischen und nicht technischen Teams. «Die Fähigkeit, Konflikte im Innovations- und Implementierungsprozess aufzufangen und aufzulösen, sowie Veränderungskompetenz sind nötig, um die KI-Strategie mitzutragen und Widerstände zu überwinden», weiss Finger. Es ist auch wichtig, zu verstehen, dass es nicht darum geht, zu lernen, wie man promptet, sondern darum, sich Gedanken zu machen, wie Prozesse ablaufen und wo Automatisierung einen Mehrwert schafft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI kein fernes Zukunftsthema ist, sondern ein wichtiger Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. KI ist gekommen, um zu bleiben, und die Unternehmen sollten die Technologie jetzt in ihren Transformationsprozess integrieren, um ihre Zukunft zu sichern.