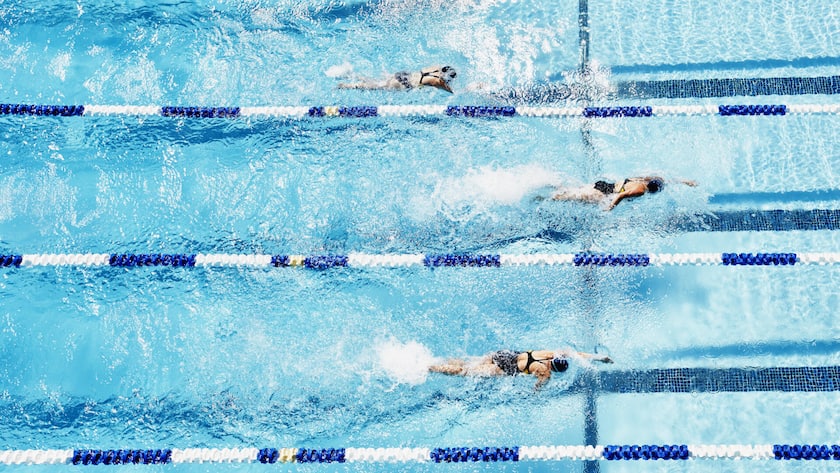Our inclusive workplace that is based on meritocracy.» Mit diesem Satz beschreibt UBS-CEO Sergio Ermotti auf der offiziellen Website der Bank den Ansatz seines Unternehmens in Bezug auf Diversity, Equity und Inclusion (DEI). Meritocracy oder deutsch Meritokratie – die Idee, dass der gesellschaftliche Aufstieg allein auf Talent, Leistung und Anstrengung beruhen soll, hat sich zum Lieblingsbegriff vieler CEOs entwickelt. Und er wird von immer mehr Firmen als Ersatz für Diversity-Programme angesehen. Es geht also nicht mehr darum, Diversität, Vielfalt und Inklusion zu fördern, sondern nur mehr pure Leistung. Andere Merkmale wie etwa das Geschlecht oder ethnische Herkunft sind kein entscheidender Faktor mehr. Der Fokus auf solche Faktoren gelte als verzerrend und sei, so die implizite Botschaft, der Leistungsorientierung abträglich.
Besonders in politisch polarisierten Zeiten wird Meritokratie zunehmend als «objektive» Alternative zu DEI propagiert. Kritiker sehen darin einen Angriff auf Gleichstellung und Inklusion, Befürworter argumentieren, dass genau dieser Fokus auf individuelle Qualifikation der gerechteste Weg für Mitarbeitende und Firmen sei.
Der neue Dreiklang: MEI – Merit, Excellence, Intelligence
Auslöser für den Kurswechsel vieler Unternehmen ist primär die politische Entwicklung in den USA. Dort wurden unter der Trump-Regierung Diversity-Trainings in Bundesbehörden als «ideologisch gefärbt» eingestuft und verboten. In mehreren Bundesstaaten folgten Gesetze, die DEI-Programme an öffentlichen Hochschulen einschränken oder ganz abschaffen.
Diese Entwicklungen zeigen Wirkung – auch in der Schweiz. Internationale Konzerne mit US-Geschäft haben begonnen, ihre Kommunikation und Strategie entsprechend anzupassen. So strich etwa die UBS in ihrem Geschäftsbericht 2024 sämtliche expliziten Verweise auf DEI. Noch 2022 ist der Begriff «Diversität» mehrfach erwähnt worden, nun heisst es nur noch, man fördere Talente «unabhängig von Herkunft oder Identität» – mit Meritokratie als leitendem Prinzip, wie Sergio Ermotti es ausdrückt.
Der Trend geht weiter: Auch in der Finanz- und Tech-Branche mehren sich Stimmen, die sich offen für eine «meritokratische Wende» aussprechen. Der Investmentfonds Azoria kündigte an, künftig nicht mehr in Unternehmen mit aktiver DEI-Agenda zu investieren. Die Begründung: Diversitätsziele seien nicht zielführend für Performance – besser sei eine klare Orientierung an Qualifikation, Exzellenz und Intelligenz.
«Wir wollen sicherstellen, dass Positionen nach objektiver Eignung vergeben werden – und nicht nach Quote», heisst es in einem Positionspapier des Fonds. Damit folgt Azoria dem Prinzip, das manche bereits als «MEI» bezeichnen: Merit, Excellence, Intelligence. Auch in zahlreichen Linkedin-Debatten oder auf Bewerbungsplattformen wird heftig gestritten, ob Meritocracy DEI-Programme ablösen soll und welche Vorteile und Nachteile das mit sich bringt.
Was sagt die Wissenschaft?
Aber auch der Begriff Meritocracy ist nicht neu und hat schon lange prominente Kritiker: Autoren wie der Harvard-Philosoph Michael Sandel warnen: Wer allein Leistung bewerte, übersehe strukturelle Ungleichheit. In seinem Buch «The Tyranny of Merit» schreibt er: «Wenn Erfolg als verdient gilt, wird Misserfolg zur persönlichen Schuld.» Auch Daniel Markovits argumentiert in «The Meritocracy Trap», dass Meritokratie in der Praxis soziale Ungleichheit verstärke, weil wohlhabende Familien ihren Kindern die besseren Voraussetzungen sichern.
Selbst in Unternehmen, die sich offiziell dem Merit-Prinzip verschreiben, schleichen sich subtile Diskriminierungen ein. Unbewusste Biases – zum Beispiel Sympathie für ähnlich tickende Kollegen (Affinity Bias), strengere Massstäbe für durchsetzungsstarke Frauen oder die Annahme, Mütter seien weniger karriereorientiert – beeinflussen die Leistungsbeurteilungen. Eine Studie des MIT-Professors Emilio Castilla deckte gar ein «Meritokratie-Paradoxon» auf: Gerade Manager, die sich für besonders meritokratisch motiviert hielten, bewerteten männliche Mitarbeiter besser und belohnten sie stärker als ebenso leistungsstarke Frauen. Die schlichte Behauptung, man sei ganz einfach für das Leistungsprinzip, hat also einige problematische Aspekte – sie kann geradezu blind machen für versteckte Bevorzugungen.
Wirklich faire Leistungsbewertung erfordert bewusste Massnahmen gegen Verzerrungen. Genau hier setzt die DEI-Arbeit normalerweise an: Sie will Barrieren abbauen, diverse Talente fördern und damit letztlich dem Merit-Prinzip zu seiner eigentlichen Geltung verhelfen. Doch dieses Selbstverständnis gerät in der aufgeheizten Debatte immer mehr in den Hintergrund.
Was bedeutet das für Schweizer Unternehmen?
In der Schweiz stehen viele Firmen vor einem Dilemma: Einerseits wird Diversität als Teil der Unternehmenskultur betont – auch im Hinblick auf Reputation und Arbeitgeberattraktivität. Anderseits wächst der Druck, sich von politisch umstrittenen Begriffen wie DEI zu distanzieren. Der Begriff Meritokratie wirkt da neutraler, sachlicher – und international anschlussfähiger.
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zeigte sich zuletzt besorgt über die Entwicklung. «Es besteht die Gefahr, dass wir wichtige Fortschritte im Bereich Gleichstellung leichtfertig zurückdrehen», sagte sie in einem Interview. «Nur weil das Wort Diversität unter Beschuss steht, dürfen wir nicht die Inhalte vergessen.»
Die Frage, ob Meritokratie DEI ersetzen soll, wird zunehmend zur Grundsatzdebatte. Die einen sehen darin einen Rückfall in alte Muster – andere eine notwendige Rückbesinnung auf objektive Standards. Was dabei immer wieder unterschlagen wird: Leistung bleibt ein zentrales Kriterium in modernen Organisationen, und DEI-Initiativen haben das Ziel, Firmen leistungsfähiger zu machen. Doch wie fair Leistung bewertet wird, hängt weniger von der Ideologie als von der Praxis ab.
Entscheidend ist, ob es gelingt, Strukturen zu schaffen, auch mithilfe von DEI-Programmen, in denen tatsächlich jede und jeder die gleichen Chancen auf Erfolg hat – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Kapital.