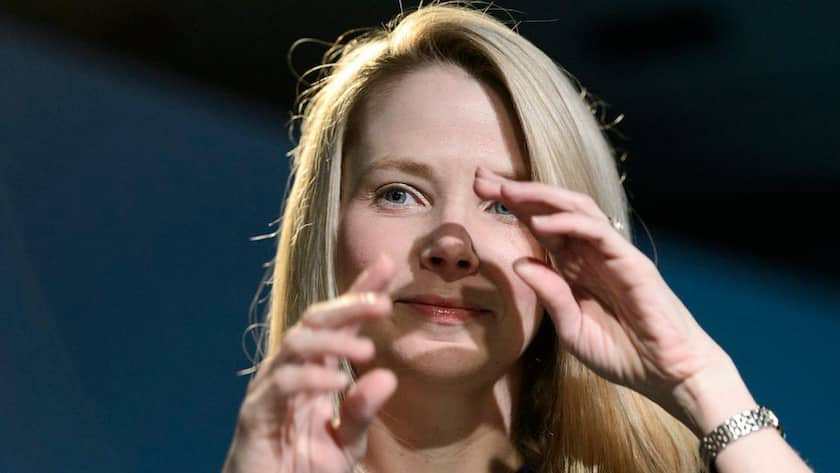Michael Moritz ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Investoren des Silicon Valley. Seine Risikokapitalfirma Sequoia Capital managt 3,2 Milliarden Dollar, zu den erfolgreichsten Beteiligungen der Vergangenheit gehörten Apple, Google, PayPal und Instagram.
Das Wort des Star-Investors hat im Silicon Valley Gewicht. Entsprechend gross war der Aufruhr Anfang Dezember, als Moritz in einem Interview mit Bloomberg zum Besten gab, die Frauen seien selber schuld, dass sie keine Jobs im Silicon Valley bekämen.
«Nicht bereit, Standards zu senken»
Moritz' Firma Sequoia Capital beschäftigt keine einzige weibliche Partnerin. Er würde sehr gern Frauen einstellen, beteuerte Moritz, aber er sei «nicht bereit, unsere Standards zu senken» für Frauen. Es gäbe einfach fast keine Frauen, die qualifiziert genug für einen Job in der Technologiebranche seien. Über Moritz brach ein wahrer Shitstorm im Internet herein – unter anderem, weil er als Quereinsteiger mit einem Geschichtsstudium vielleicht selber nicht so fürchterlich überqualifiziert ist.
Die Wut auf Moritz war aber auch so gross, weil er einen wunden Punkt des Silicon Valley anspricht. Obwohl das Tal zwischen San Francisco und San José als die technisch innovativste Region der Erde gilt, ist es bei seiner Personalpolitik geradezu archaisch rückwärtsgewandt.
Wer über die Flure von Facebook, Twitter, Google und Co geht, der wird viele, sich ähnelnde Menschen sehen: Sie sind weiss, sie sind männlich, sie kommen von den besten Universitäten des Landes, sie tragen Jeans, Polohemden, Kapuzenpullis. Die Tech-Branche gleicht einer geschlossene Gesellschaft. Obwohl Gleichberechtigung in der amerikanischen Unternehmenskultur eigentlich sehr hoch angesehen wird, haben Frauen und Schwarze immer noch Exotenstatus im Silicon Valley.
Nur 10 Prozent der Manager im Silicon Valley sind weiblich
Die Anwaltsfirma Fenwick & West hat in einer aktuellen Studie die Führungsspitze der 150 grössten Silicon-Valley-Konzerne mit dem Management der 100 grössten US-Unternehmen im Aktienindex S&P verglichen. Ergebnis: Nur zehn Prozent der Manager im Silicon Valley sind weiblich, beim Durchschnitt der grössten US-Firmen sind es doppelt so viele.
Kaum besser sieht es aus, wenn man den Frauenanteil über alle Hierarchiestufen hinweg vergleicht. In der Tech-Branche sind nur 25 Prozent der Mitarbeiter Frauen, im US-Durchschnitt liegt der Frauenanteil dagegen bei 47 Prozent.
Die Frauen sind allerdings noch gut vertreten, vergleicht man sie mit ethnischen Minderheiten: 68 Prozent aller Tech-Mitarbeiter sind weiss, 17 Prozent Asiaten, sieben Prozent sind schwarz, sechs Prozent Latinos, und zwei Prozent gehören einer anderen Ethnie an.
«Pipeline» ist längst nicht so leer, wie die Firmen behaupten
Warum das so ist, darüber gibt es verschiedene Theorien. Viele der Silicon-Valley-Firmen, die sich doch eigentlich als multikulturelle, globale Konzerne mit Weltverbessererattitüde vermarkten wollen, schieben es auf einen Mangel an Angebot. Ein oft gehörtes Stichwort ist das «Pipeline-Problem». Die Argumentation lautet: Wir hätten gern mehr Frauen und Farbige, aber es gibt einfach keine qualifizierten Bewerber.
Zumindest was Frauen angeht, kann die Pipeline-Theorie nicht das gesamte Ausmass des Problems erklären. Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat im Juni 2015 für eine Studie ihre Mitgliederdatenbank nach Frauen durchsucht, die in IT-Jobs arbeiten. Ergebnis: Ausserhalb der Tech-Industrie ist der Frauenanteil in den IT-Abteilungen wesentlich grösser als im Silicon Valley. In der Gesundheitsbranche liegt er beispielsweise bei 32 Prozent, in der Handelsbranche bei 28 Prozent, in der Finanzindustrie bei 26 Prozent, in Tech-Firmen dagegen nur bei 20 Prozent.
Es stimmt also: Traditionell arbeiten im IT-Bereich mehr Männer als Frauen. Viele derjenigen Frauen, die ein Ingenieur- oder Informatikstudium abschließen, entscheiden sich jedoch bewusst gegen eine Karriere im Silicon Valley – obwohl die Jobs dort als besonders interessant und gut bezahlt gelten.
«Brogrammer»-Kultur schreckt Frauen ab
Der Grund scheint in der geschlossenen «Brogrammer»-Kultur der Silicon-Valley-Firmen zu liegen. «Brogrammer» – eine Wortneuschöpfung aus «brother» und «Programmierer» – sind Jungs, die nächtelang auf Hackathons ihre technischen Kräfte messen, sich von leicht bekleideten «Code Babes» Pizza und Bier servieren lassen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenn sie in einer solchen Nacht eine App namens «Titstare» programmiert haben: Die App nimmt Selfies von Smartphone-Nutzern auf, während diese auf Fotos von nackten Brüsten glotzen.
Jede Frau, die schon mal auf einer Tech-Konferenz gewesen ist oder im Silicon Valley arbeitet, kann solche Geschichten erzählen. Zum Beispiel die von Matt Van Horn, dem ehemaligen Chef des sozialen Netzwerks Path, der bei einer «South by Southwest»-Konferenz stolz auf der Bühne erzählte, er habe sich mal mit «Bikinibildchen aus einem Nacktkalender» für einen Job beworben. Oder die von Candace Fleming, der Gründerin des Start-ups Crimson Hexagon, der von einem Risikokapitalgeber empfohlen wurde, auf ihre Visitenkarte «Mom» als Berufsbezeichnung zu schreiben.
«Frau im Vorstand? – ein Witz»
Viele Frauen dürfte auch die wachsende Zahl an Diskriminierungsklagen im Silicon Valley abschrecken. Eine der prominentesten wurde von Whitney Wolfe geführt, der Mitbegründerin der Dating-App «Tinder». Einer der anderen Gründer hatte Wolfe aus dem Management gemobbt. Seine Begründung: Eine Frau im Vorstand lasse «die Firma wie einen Witz aussehen». Die Kontrahenten einigten sich aussergerichtlich.
Zu einem stillschweigenden Vergleich kam es auch bei der Klage gegen einen Partner der Risikokapitalfirma CMEA. Er soll eine Reihe von Assistentinnen behandelt haben, als wäre er geradewegs aus der Serie «Mad Men» entsprungen: Er gab ihnen sexuell eingetönte Spitznamen, sperrte sie in seinem Büro ein oder ärgerte sie mit Bemerkungen über Pornofilme und Schamhaare.
Frauen bei Geschäftsessen «versauen die Stimmung»
Im vergangenen Frühjahr wurde dagegen eine Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin gegen die Risikokapitalfirma Kleiner Perkins Caufield & Byers abgelehnt. In dem Gerichtsprozess kamen trotzdem Anekdoten zu Sprache, die das Unternehmen für Frauen mehr als unattraktiv machen. Eine der Partnerinnen erzählte beispielsweise unter Eid, dass der frühere Vizepräsident der Firma sie nicht zu einem Geschäftsessen eingeladen hätte, weil Frauen «die Stimmung versauen». Ein anderer Manager hatte einer jungen Mitarbeiterin gesagt, sie solle sich doch «geschmeichelt» fühlen, dass ein männlicher Kollege nachts nur im Bademantel vor ihrer Hotelzimmertür auftauchte.
Die frauenfeindliche Kultur der Firmen ist nicht nur für die Frauen ein Problem, sondern auch für die Unternehmen selbst. Das lässt sich leicht an den Risikokapitalfirmen im Silicon Valley belegen. Nur vier Prozent der Investoren in der Tech-Branche sind Frauen. Dementsprechend tun sich Start-up-Gründerinnen viel schwerer als Gründer, an Venture-Kapital zu kommen. Von den 6517 Firmen, die in den Jahren 2011 bis 2013 im Valley Risikokapital erhalten haben, waren nur 2,7 Prozent unter weiblicher Führung. Und das, obwohl weiblich geführte Start-ups statistisch gesehen eine 31 Prozent höhere Kapitalrendite erwirtschaften.
Vielfalt führt zu besseren Geschäftsergebnissen
Es gibt Hunderte von Studien, die belegen, dass Unternehmen bessere Ergebnisse erwirtschaften, die eine kulturell vielfältige Belegschaft haben: Je mehr Mitarbeiter unterschiedlicher Geschlechter, Religionen, Altersklassen, Herkunft, sexueller Orientierung und Ethnien bei einem Unternehmen arbeiten, desto besser können auch die unterschiedlichsten Kundengruppen angesprochen werden.
Einige Silicon-Valley-Firmen wie Intel, Google oder Facebook haben das Problem erkannt und sich Ziele gesetzt, mehr Mehrarbeiter einzustellen, die nicht weiss und männlich sind. Sie haben auch deswegen ein Interesse daran, weil der Fachkräftemangel im Silicon Valley immer eklatanter wird. Bislang sind die Ergebnisse der verschiedenen Initiativen allerdings eher dürftig – wohl auch, weil man eine Kultur nicht über Nacht verändern kann.
Auch Minderheiten sind selten vertreten
Es sind nicht nur die Frauen, die vom Silicon Valley weitgehend ausgeschlossen werden, sondern auch ethnische Minderheiten. Hier tragen die Konzerne aber eine geringere Schuld als beim Frauenanteil. Denn fairerweise muss man sagen: Während rund jeder zweite Amerikaner eine Frau ist, zeichnen sich Minderheiten eben dadurch aus, dass sie wenige sind.
Eine der grössten Randgruppen in den USA ist mit einem Anteil von 13 Prozent die schwarze Bevölkerung. Mit einem Anteil von sieben Prozent an der Belegschaft im Silicon Valley sind sie einerseits unterrepräsentiert. Andererseits sind auch nur 4,5 Prozent aller Informatikabsolventen schwarz. Zumindest bei der Hautfarbe gibt es also offenbar tatsächlich ein Pipeline-Problem: Die schwarze Bevölkerung ist statistisch gesehen immer noch wesentlich schlechter ausgebildet als die weisse. Bei den Latinos ist die Problemlage ganz ähnlich.
Bei Twitter kennen sich alle Schwarzen untereinander persönlich
Trotzdem beschweren sich die wenigen Schwarzen, die es im Silicon Valley gibt, über Alltagsrassismus in den Unternehmen. Einer davon ist Mark S. Luckie, der bis Mai 2015 als Nachrichtenchef bei Twitter arbeitete. Im September schrieb er einen langen Artikel in der «USA Today» über seine Erfahrungen als Schwarzer bei dem Kurznachrichtendienst. Nur zwei Prozent der Belegschaft bei Twitter seien demnach schwarz, untereinander kenne jeder jeden persönlich, so selten treffe man mal einen mit gleicher Hautfarbe. Seiner Meinung nach gibt es wenig Hoffnung auf Änderung. «Mitarbeiter werden angehalten, Freunde oder ehemalige Kollegen als potenzielle Mitarbeiter für offene Stellen zu empfehlen.» Das sei überall im Silicon Valley üblich und würde zu einer Verstärkung der Monokultur führen.
Doch selbst wenn doch mal ein schwarzer Mitarbeiter angestellt wird, hat der gleich das nächste Problem. «Farbige Mitarbeiter werden deutlich schlechter bezahlt als weisse», schreibt Luckie. Das belegt im Übrigen auch eine Studie des American Institute for Economic Research. Das Institut verglich die Gehälter in hoch qualifizierten Tech-Jobs wie Computerprogrammierer und Softwareentwickler. Ergebnis: Latinos verdienen 16'353 Dollar weniger Jahresgehalt als Weisse mit gleicher Qualifikation, Asiaten bekommen durchschnittlich 8146 Dollar und Schwarze 3656 Dollar weniger.
All das schrecke ethnische Minderheiten ab, sich bei Tech-Firmen zu bewerben. Sie gehen lieber in die Autoindustrie oder die Ölbranche, wo Schwarze sich weniger wie seltsame (und unterbezahlte) Einhörner fühlen. Auch Luckie kündigte im Mai bei Twitter, weil er keine Lust mehr hatte: Als schwarzer Mitarbeiter bei Twitter habe er sich ständig wie «der einzige Mann auf einem Junggesellinnenabschied» gefühlt.
Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Schwester-Publikation «Die Welt» unter dem Titel «Silicon Valley: Frauen und Schwarze müssen draußen bleiben».